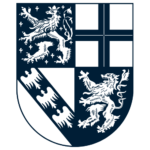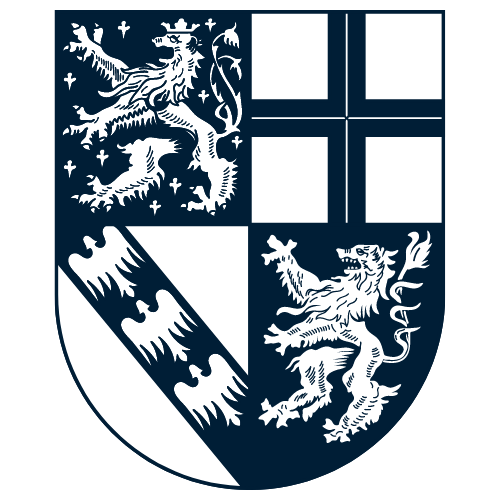Was ist das Behindertentestament?
Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei dem Behindertentestament um eine besondere Form des Testaments. Allerdings wird dieses nicht, wie man vom Namen her ebenfalls vermuten könnte, von dem behinderten Menschen selbst errichtet, sondern von den Angehörigen, z.B. den Eltern, des behinderten Menschen.
Es ist folglich eine letztwillige Verfügung in Form eines Testaments oder bei Ehegatten oft in der Form des Erbvertrages, wobei mindestens ein Erbe aufgrund seiner Behinderung auf staatliche rückforderbare Hilfe angewiesen ist. Dabei verfolgt es den Zweck, dass ein behinderter Mensch mit Hilfe des Nachlasses seinen Lebensstandard über die Basis des Sozialhilfeniveaus heben kann.
Der Grund für die Errichtung des Testaments
Ein behinderter Mensch kann einen Anspruch auf die sog. Eingliederungshilfe haben. Darunter fallen nach § 102 SGB IX Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Sozialen Teilhabe. An diesen Leistungen müssen sich die betroffenen behinderten Menschen oder im Falle ihrer Minderjährigkeit ihre Eltern, abhängig von Ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen beteiligen. Das Erbe zählt zum Vermögen und muss ggfs. auch rückwirkend eingesetzt werden.
Ergibt sich nun der Fall, dass die Eltern versterben und ihr behindertes Kind Erbe wird, dann erlangt dieses mit dem Erbe eigenes Vermögen. Damit dieses Vermögen nicht vollständig zur Finanzierung der staatlichen Leistungen der Vergangenheit und der Zukunft verwendet werden muss und das behinderte Kind die Möglichkeit hat, sich neben den Pflegeleistungen auch persönliche Wünsche, wie Hobbys und Urlaube zu leisten, lohnt es sich, über die Errichtung eines Behindertentestaments nachzudenken.
Wie wird das Behindertentestament errichtet?
Klassischerweise setzt man in dem Behindertentestament eine Vor- und Nacherbschaft in Kombination mit einer Dauertestamentsvollstreckung fest, sog. Erbschaftslösung.
Dabei wird das behinderte Kind zunächst als Vorerbe eingesetzt. Als Vorerbe, ist man echter Erbe des Erblassers und kann über das Erbe verfügen (§ 2100 BGB). Allerdings ist man grundsätzlich gesetzlich in der Verfügungsbefugnis beschränkt. Demnach darf man den Wert der Erbschaft nicht verbrauchen, sondern muss diesen für die Nacherben erhalten. Dafür wird die Verwendung der Erbschaft nach vorgegebenen Regeln von dem zusätzlich bestimmten Testamentsvollstrecker verwaltet. Der Vorerbe ist anders formuliert ein „Erbe auf Zeit“. Folglich darf das Vermögen nicht vollständig zur Finanzierung der Pflege verbraucht werden.
Als Nacherbe werden dann meistens weitere Kinder des Erblassers, sonstige Abkömmlinge oder auch gemeinnützige Organisationen eingesetzt. Der Nacherbe erbt vom gleichen Erblasser wie der Vorerbe, nur eben erst nach dem Tod des Vorerben.
Für die Verwaltung des Vermögens des Vorerbens muss lebenslang ein Testamentsvollstrecker festgelegt werden. Damit liegt die Verfügungsgewalt über das Vermögen nicht bei dem behinderten Menschen, sondern beim Testamentsvollstrecker. Dieser verwaltet nach den Vorgaben des Testaments das Vermögen des behinderten Menschen.
Was muss beachtet werden?
Bei der Errichtung des Testaments muss insbesondere darauf geachtet werden, dass der behinderte Mensch als Vorerbe mit einer Erbquote knapp über dem Pflichtteil eingetragen wird. Ansonsten hat der behinderte Mensch einen Pflichtteilsanspruch. Dieser Anspruch kann nach § 93 SGB XII auf den Sozialträger übergehen, womit man das Ziel des Behindertentestaments nicht mehr erreicht.
Das gleiche schlechte Ergebnis stellt sich ein, wenn das behinderte Kind enterbt wird, da auch dann ein pfändbarer Pflichtteilsanspruch entsteht.
Daneben sind auch Schenkungen zu Lebzeiten an die anderen Kinder zu beachten. Diese haben Einfluss auf den Gesamtumfang der Erbmasse und die Berechnung des Pflichtteils der einzelnen Erben, insbesondere kann beim behinderten Kind ein Pflichtteilsergänzungsanspruch entstehen, falls die Schenkung (innerhalb der letzten 10 Jahre) bei der Pflichtteilsberechnung beachtet wurden muss. Folglich müssen lebzeitige Zuwendungen an weitere Abkömmlinge aufgrund komplexer Hintergründe bedacht getroffen werden.
Scheuen Sie sich nicht, bereits hierfür notarielle Beratung zu suchen, um die Auswirkung auf das Behindertentestament schnellstmöglich zu erkennen und zu verhindern.
Fazit
Bei dem Behindertentestament handelt es sich keinesfalls um den „goldenen Weg“, allerdings ist es eine gute Möglichkeit das Vermögen des behinderten Kindes zu bewahren und es zu schützen.
Dabei ist das Thema hochkomplex und es gibt keine Patentlösung. Um Ihre persönliche Situation bestmöglich zu unterstützen, ist die notarielle Beratung lohnenswert.