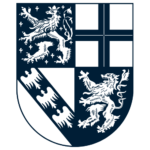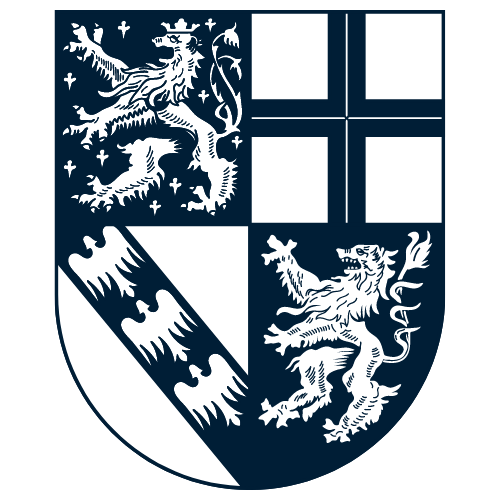Eine plötzlich auftretende Krankheit oder ein Unfall können zur Folge haben, dass Sie Ihre persönlichen Dinge (rechtlich) nicht mehr selbst regeln können und Sie darauf angewiesen sind, dass andere für Sie entscheiden.
Sicher haben Sie schon gehört, dass Sie diesem Fall der Fälle mit einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung begegnen sollen. Aber wieso eigentlich? Es gibt doch zahlreiche gesetzliche Regelungen zum Betreuungsrecht! Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung?
Die rechtliche Betreuung
Die rechtliche Betreuung dient der Unterstützung von Erwachsenen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung ihre eigenen rechtlichen Angelegenheiten nicht (mehr) wahrnehmen können. Der vom Betreuungsgericht bestellte und kontrollierte Betreuer unterstützt die betroffene Person innerhalb eines genau festgelegten Aufgabenbereichs dabei, ihre Angelegenheiten zu regeln und macht von seinem Vertretungsrecht nur dann Gebrauch, wenn dies erforderlich ist. Die betreute Person wird dabei nicht entmündigt und sie wird auch nicht durch die Betreuerbestellung geschäftsunfähig.
Zum 01.01.2023 trat eine umfassende Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts in Kraft. Ziele der Reform sind die Stärkung der Selbstbestimmung unterstützungsbedürftiger Menschen im Vorfeld und innerhalb einer rechtlichen Betreuung, die Verbesserung der rechtlichen Qualität der Betreuung und die Verbesserung der Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes und Sicherstellung, dass ein rechtlicher Betreuer nur dann bestellt wird, wenn dies zum Schutz des Betroffenen erforderlich ist. Die Wünsche der betreuten Person sollen dabei noch stärker als bisher in den Mittelpunkt gerückt werden.
Neben zahlreichen inhaltlichen Änderungen wurden viele Vorschriften aus dem Vormundschaftsrecht in das Betreuungsrecht verschoben, damit sachlich zusammenhängende Vorschriften nun auch im Gesetz konzentriert in den §§ 1814 ff. BGB zu finden sind.
Das neue Ehegattennot-Vertretungsrecht
In § 1358 BGB wurde ein sogenanntes gegenseitiges Ehegattennotvertretungsrecht eingeführt. Es gilt jedoch nur in Gesundheitsfragen und ist zeitlich auf sechs Monate beschränkt. Eingetragene Lebenspartner sind gemäß § 21 LPartG gleichgestellt.
Das Vertretungsrecht besteht nur und soweit der andere Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit nicht in der Lage ist, die in der Vorschrift genannten Angelegenheiten der Gesundheitssorge zu besorgen. Wie sich dies zur sonst für die Vertretung in Gesundheitsfragen erforderlichen Einwilligungsunfähigkeit des Patienten verhält, ist noch unklar.
Jedenfalls wird der vertretende Ehegatte zum Schutz des erkrankten Ehegatten den gleichen Bindungen unterworfen wie ein Vorsorgebevollmächtigter oder gerichtlich bestellter Betreuer.
Das Gesetz sieht auch Ausschlussgründe vor, bei denen dem Ehegatten kein Vertretungsrecht zukommt, z.B. bei Getrenntleben oder Bevollmächtigung einer anderen Person in einer Vorsorgevollmacht. Sollten Sie das Ehegattennotvertretungsrecht nicht wünschen, besteht zudem die Möglichkeit, einen Widerspruch im zentralen Vorsorgeregister eintragen zu lassen. Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die neue gesetzliche Regelung in der Praxis Anwendung finden wird.
Die Vorsorgevollmacht
In einer Vorsorgevollmacht können Sie eine Person, die Ihr volles Vertrauen genießt, bevollmächtigen, im Umfang der erteilten Vollmacht Ihre Angelegenheiten zu regeln, wenn Sie es selbst nicht mehr können.
Dabei ordnet das Gesetz eine Subsidiarität der gerichtlichen Betreuung an. Das bedeutet, die Vorsorgevollmacht hat stets Vorrang vor einer gerichtlich angeordneten Betreuung. Sie ist Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts und der Privatautonomie. Die bevollmächtigte Person unterliegt in deutlich geringerem Umfang einer Aufsicht und Kontrolle durch das Betreuungsgericht als ein gerichtlich bestellter Betreuer und sie muss dem Gericht auch keine Rechenschaft ablegen. Nur in wenigen Fällen der Gesundheitssorge besteht eine Genehmigungspflicht durch das Gericht.
Auch deshalb ist die Grundvoraussetzung einer Vorsorgevollmacht bedingungsloses Vertrauen zu der von Ihnen bevollmächtigten Person.
Die Vorsorgevollmacht bietet weiterhin viele Vorteile: Sie können selbst bestimmen, wer Ihre Interessen wahrnimmt, Sie vermeiden ein für alle Beteiligten belastendes Betreuungsverfahren und dessen Kosten und Sie ermöglichen ein flexibles und schnelles Handeln.
Die Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung können Sie für den Fall Ihrer Einwilligungsunfähigkeit in medizinischen Angelegenheiten vorsorglich schriftlich festlegen, welche medizinischen Maßnahmen durchzuführen bzw. zu unterlassen sind. An Ihre Entscheidungen sind die Ärzte und Ärztinnen und Pflegekräfte gebunden.
Um Ihrer Patientenverfügung die nötige Durchsetzungskraft zu verleihen, sollten Sie sie jedoch stets mit einer Vorsorgevollmacht verbinden. Es ist dann die Aufgabe der von Ihnen bevollmächtigten Person, Ihrem mit der Patientenverfügung ausgedrückten Willen Geltung zu verschaffen.
Warum zum Notar?
Grundsätzlich ist für die Wirksamkeit einer Vorsorgevollmacht und einer Patientenverfügung die notarielle Beurkundung nicht erforderlich. Sie bringt jedoch viele Vorteile mit sich.
Sofern Sie dies wünschen, können Sie die zum Bevollmächtigten ernannte Peron ermächtigen, über Ihre Immobilie(n) zu verfügen. Der Verkauf Ihres Hauses oder die Aufnahme eines mit einer Grundschuld gesicherten Darlehens ist jedoch nur möglich, wenn die Vorsorgevollmacht notariell beurkundet wurde. Zudem weisen Sie mit der notariellen Beurkundung nach, dass Sie die Vorsorgevollmacht erteilt haben, als Sie noch voll geschäftsfähig waren.
Die notarielle Beurkundung bietet Ihnen Rechtssicherheit und garantiert die uneingeschränkte Akzeptanz der Vorsorgevollmacht im Rechtsverkehr und im Krankenhaus.